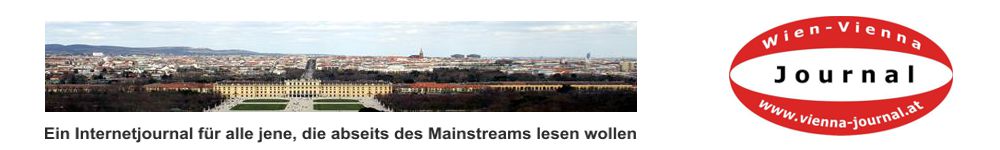Während der Autorentage beteiligte ich mich an einem interessanten Gespräch, das immer noch in mir nachklingt und mich nun dazu bringt, ein wenig über die Motivationen des Schreibens zu reflektieren.
„Man schreibt entweder für das Ego, oder um Geld zu verdienen“, hörte ich jemanden sagen und wandte ein: „Vielleicht ist es auch möglich, dass mancher schreibt, um Vergnügen und Spannung zu bereiten.“ Dafür erntete ich zum einen zustimmendes Nicken, zum anderen aber auch erstaunte Blicke. Ist dieses Motiv in unserer Zeit nicht mehr relevant, ist es etwa zu idealistisch?
Ich erinnere mich, dass ich selbst so gut wie immer nur las, um Spannung und Vergnügen zu haben. So ganz nebenbei lernte ich eine Menge, ohne dass es mir bewusst wurde. Immer wieder stieß ich auf Bücher, die mich schlichtweg „vom Hocker rissen“, geriet aber auch an andere, die zu lesen ich mich zwang (weil man sie „gelesen haben sollte“). So wurde ich beispielsweise mit einigen sehr berühmten Autoren nicht warm, Thomas Mann etwa oder James Joyce. Der erstere machte mir zu lange Sätze – vielleicht startete ich auch mit dem „falschen“ Roman – und der zweite war mir erst recht unverständlich. Ich konnte nie wirklich dahinterkommen, was denn die Kriterien für die Verleihung des Literaturnobelpreises sind. Und hätte ich mir die Warnung Mark Twains zu Herzen genommen, der das Buch Mormon als „gedrucktes Chloroform“ bezeichnete, wäre es mir erspart geblieben, bei dessen Lektüre tatsächlich mit dem Schlaf zu kämpfen.
Also nahm ich mir vor, begeistert zu schreiben, leidenschaftlich, kraftvoll und intensiv, um mindestens ebensoviel Begeisterung zu schaffen wie ich selbst bei der Lektüre meiner Favoriten empfunden habe.
Es ist nicht immer einfach, beim Schreiben eigene Wünsche völlig auszublenden, den nach einem Riesenerfolg etwa, der sich nicht nur in Geld, sondern in öffentlicher Anerkennung und mindestens europaweiter Bekanntheit misst. Sie führen aber in die Irre, wenn ich geben möchte: Vergnügen, Unterhaltung, Spannung, Kribbel, Aha-Erlebnisse, Lachen, interessante Informationen, Denkanstöße, all das verpackt in eine gute Rechtschreibung und Grammatik und transportiert durch einen flüssigen Stil. Wenn mir das nicht gelänge – so schwor ich mir, als ich begann – würde ich auf der Stelle mit dem Schreiben aufhören. Ein Schreibender, der nur nehmen will (Anerkennung, Erfolg, Geld, Lob usw.), mag sich dafür legitimiert fühlen und findet unter Umständen sogar Jurys, die ihm Preise verleihen, aber ich fürchte, dass er auf weit mehr Unehrlichkeit als Begeisterung stößt. Einfühlsame Menschen werden ihn unter Umständen sogar als eine Art Bettler empfinden, der ihnen zur Last fällt.
Nach dem Erscheinen meines allerersten Buches (2002) bewiesen mir erste, spürbar begeisterte Rückmeldungen und die allgemeine Stimmung nach den ersten Lesungen, dass es mir zunächst gelungen war, meinem Anspruch gerecht zu werden. Nun durfte ich keinesfalls mehr hinter ihn zurückfallen, ließ mich nicht durch die Aufs und Abs des mir immer geläufiger werdenden Literaturbetriebes beirren und schrieb weiter. Einesteils das, was in mir war, andererseits so, wie es sich in ständiger innerer Zwiesprache mit meinen potenziellen Lesern ergab.
Die Fragen „Wie würde dir dieses Buch gefallen, wenn es das eines völlig Unbekannten wäre? Würdest du es gern lesen? Macht es dir Spaß, immer weiter zu lesen, oder langweilt es dich spätestens nach den ersten zwei Seiten?“ legte ich mir bei meinen eigenen Texten ständig vor; sie wurden sozusagen mein Schlüssel. Das mag nicht die Herangehensweise eines jeden Autors sein, und für manche klingt es vielleicht sogar ziemlich unrealistisch. Doch was mich betrifft, so möchte ich mit dem, was ich schreibe, unbedingt mehr geben als nehmen. Es ist die einzige Haltung, die mich auch selbst erfüllt.
Andreas H. Buchwald Greith, 25. Oktober 2019