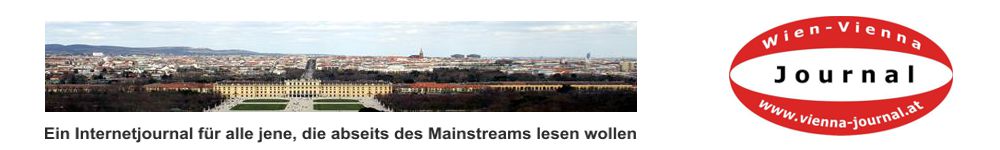Filmkritik: „Der Teufelsgeiger“
Nachdem ich, wie einige hundert andere, vor einem Jahr als Statistin bei den Dreharbeiten zum Film dabei gewesen war, ging ich gestern mit großen Erwartungen ins Kino zum “Teufelsgeiger “.
Mir ist durchaus klar gewesen, dass sowohl die Macher als auch die Zuseher gewisse Abstriche machen müssen, da das bekannte Problem mit Musikfilmen oder Filmen über Musiker immer folgendes ist: entweder mimt ein Schauspieler eine Musikerpersönlichkeit, oder ein Musiker versucht sich an einer Rolle. Daraus ergibt sich, dass man immer Kompromisse eingehen muss. Nun, diesmal haben wir einen Vollblutmusiker von Weltformat, der ein grandioser Violinist ist und daher in das Leben eines anderen genialen Geigers eintauchen können sollte. David Garrett hat in einem kürzlich gegebenen Interview mit seiner sympathischen Art glaubhaft versichert, dass er nur diese eine Rolle in seinem Leben spielen wollte und sich sonst nicht mehr als ‚Schauspieler‘ versuchen will. Dazu wird ihm vermutlich auch jeder raten, der diesen Film gesehen hat. Das Traurige ist, dass man sich für ihn und alle Beteiligten wünscht, dass dieses Projekt besser verwirklicht worden wäre.
Aber von Anfang an:
Der Film beginnt mit einer kurzen Szene, die Paganinis strenge, unverstandene Kindheit zeigt, um dann gleich mehr als ein Jahrzehnt zu überspringen und in seiner jungen, noch erfolglosen, Zeit in Italien fortzusetzen. Während der Umbaupause einer Oper spielt er vor dem Vorhang seine Tiermelodien, um das Publikum zu unterhalten, erntet aber nur Hohn und Spott. Jedoch sieht ihn dort an diesem Abend Signor Urbani (Jared Harris), der vorläufig als Einziger die Genialität von Paganinis Kompositionen erkennt-und ihn daraufhin am nächsten Morgen im Hotel aufsucht. Dieser steckt inzwischen in finanziellen Schwierigkeiten, welche Urbani für ihn begleicht. Diese großartige Szene ist ganz auf Jared Harris zugeschnitten, um, etwas ausholend, das Infernalische dieses Charakters aufzuzeigen. Das gelingt ihm mit musikalischer Untermalung des ErlkönigThemas (Schubert) ausnehmend gut und fesselnd. Nur werden zu viele Parallelen zu Goethes Mephisto zitiert, die bis zum Ende des Films immer wieder zur Genüge ausgereizt werden. Nun, ein bisschen Plakativität verträgt ein Film dieses Genres durchaus, wenn diese sich auch in anderen Szenen mehr durchsetzten würde. Signor Urbani bringt den jungen, naiven Nicolo Paganini dazu, ihm seine Karriere anzuvertrauen. Fast erwartet man, dass der Violinist mit Blut unterschreiben soll…
Leider wird auch gleich in dieser Szene das große Problem sichtbar: in den wenigen Sätzen, die in diesem ersten Dialog gewechselt werden, scheint Davids bemessenes schauspielerisches Talent schon durch. An Mimik und sprachlicher Ausdrucksweise wird schnell klar, dass dieser wundervolle Geigenspieler mit Schauspielen leicht überfordert ist.
Danach macht die Handlung wieder einen großen Sprung, wodurch einige Handlungsstränge fehlen, und setzt an der Stelle an, an welcher Nicolo bereits, dank Urbanis Hilfe, berühmt, gefeiert, aber auch drogensüchtig ist. Er soll nach London fahren, um dort Konzerte zu geben, lässt sich aber immer wieder im Vorhinein Geld schicken, das er schleunigst am Spieltisch verprasst. Aus diesem Grund schiebt er diese Reise immer wieder auf. Auch hat er plötzlich einen Sohn von circa 6 Jahren und das Publikum wird im Unklaren gelassen, wer und wo dessen Mutter ist. Aber zumindest die Zuneigung zu diesem Kind glaubt man Davids Paganini.
Übrigens sind nahezu alle Charaktere mit hervorragenden Schauspielern besetzt. Vor allem die Männer glänzen durch Souveränität und durch fesselnde Sprache und Spiel. Warum Veronica Ferres immer und überall dabei sein muss, ist manchem wohl schleierhaft und womöglich auch lästig. Denn längst ist sie nicht mehr die schöne, besonders weibliche Blondine, die vor rund 20 Jahren noch frischen Wind in die Deutsche Filmwelt gebracht hat. Das Einzige, das man ihr abkauft, ist der Neid der Stiefmutter auf die junge und begabte Stieftochter. Sonst verblasst sie zunehmend zwischen den großen Schauspielern.
Andrea Deck wiederum verkörpert äußerst glaubhaft das junge, musikalische Mädchen Charlotte, welches sich nach anfänglichem Trotz und Widerwillen in den mittlerweile arroganten und komplizierten Paganini verliebt. Hierbei gibt es einige lustige Szenen in London, wohin der Violinist von Charlottes Vater (Christian McKay) engagiert wird. McKay mimt einen ungemein skurrilen, liebenswerten und amüsanten Künstleragenten, der als naiver Vater äußerst glaubhaft agiert. Dass Andrea die anspruchsvolle Arie selbst einsingt, nimmt den Zuseher vollends für sie ein. Ihre Stimme ist angesichts ihrer Jugend besonders faszinierend, selbst wenn natürlich die Tontechnik heutzutage sicher manches zur Dynamik und zum Timbre beigetragen hat.
Überhaupt sind alle musikalischen Szenen, vor allem jenen der Konzerte, mit großem Aufwand, (400 Statisten waren dabei allein an den Drehtagen bei welchen die Innenansichten des London Royal Opera House im Theater an der Wien und in den Rosenhügelstudios gedreht wurden!) Leidenschaft, Hingabe und beachtlichem Spürsinn gedreht und umgesetzt worden.
Wenn David spielt, spürt man in jeder Kameraeinstellung die Kraft und Wahrhaftigkeit und sein Gesicht zeigt einem die Hingabe und Konzentration, aus diesen Musikstücken das Beste rauszuholen. Die unglaublich schwierigen Caprices (Nr. 4, 5 und 10) springen nur so von seinen Saiten, dass einem der Mund offen bleibt vor Staunen. Sobald er die Geige in die Hand nimmt, ist dieser Zauber da. Plötzlich glaubt man ihm seinen Paganini, seine Genialität, seine Leidenschaft und wird mitgerissen von den Massenszenen, den fulminant gespielten Stücken und will am liebsten mit der Menge mitjubeln (wie damals beim Dreh). Jedes einzelne Musikstück hat David übrigens selbst ausgesucht und vor der Kamera immer wieder und wieder perfekt live über die bereits vorhandenen Studioaufnahmen gespielt.
Nur fehlt einem umso mehr im Rest des Films dieses Prickeln, dieses Feuer, das Drama. Hingegen sind die Kostüme, die Settings und die Requisiten alle detailgetreu und liebevoll ausgesucht, sodass man vieles genauer bestaunen möchte. Aber gleichzeitig wird der Zuseher immer wieder von Dialogszenen enttäuscht, da diesen leider nicht dieselbe Aufmerksamkeit und Intensität gewidmet wurde. Selbst in den häufigen Bettszenen fehlt das gewisse erotische und wilde Etwas, das Provokative das man erwartet hat.
Schlussendlich brilliert Paganini auch in London, verzaubert sogar den König und hat sein Herz an die süße, aber zu junge, Charlotte verloren. Diese Liebe erfüllt sich aber aufgrund der Intrige einer Journalistin nicht. Joely Richardson, Tochter von Vanessa Redgrave, verkörpert hier sehr glaubhaft diese Londoner Journalistin, welche ebenso dem Charme des Geigers verfällt. Diese Rolle ist zwar insgesamt sehr plakativ gestaltet, bringt aber einen gewissen modernen Touch hinein.
Der Schluss ist leider wieder ziemlich fad und einfallslos gestaltet. Möglicherweise wurde auch in der Postproduktion geschusselt, oder einfach zu wenig am vorhandenen Material gebastelt? Paganini ist mittlerweile krank, ausgelaugt und dem Opium so sehr verfallen, dass er sich in sein Haus in Italien zurückzieht, um dort schlussendlich zu sterben. Den teuflischen Urbani entlässt er zu spät aus seinen Diensten. Zu diesem Zeitpunkt ist er nicht mehr zu retten.
Fazit: Musiker und Musikliebhaber werden von den musikalischen Szenen begeistert sein und versuchen über die Schwächen des Schauspieles und die Handlungslücken hinwegzusehen. Wunderbare Kostüme und Schauplätze, Ohrenschmaus in jeder Hinsicht und eine gute Besetzung gleichen Davids nicht glanzvolle schauspielerische Leistung wieder aus.
Veronika Schmidt-Levar